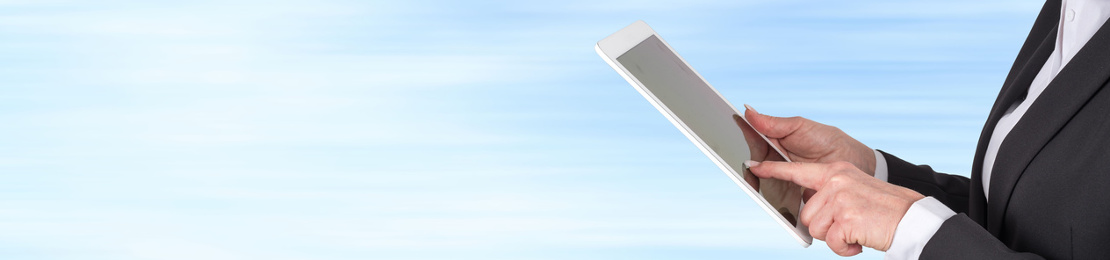2020.1-I
Änderung der Bekanntmachung eines Musters für eine gemeindliche Wasserabgabesatzung
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 20. Februar 2019, Az. B1-1405-2-9
- 1.
- Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über ein Muster für eine gemeindliche Wasserabgabesatzung vom 13. Juli 1989 (AllMBl. S. 579), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 29. März 2010 (AllMBl. S. 112) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.1
- Anlage 1 wird wie folgt geändert:
- 1.1.1
- In dem Einleitungssatz vor § 1 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 2 bis 4“ ersetzt.
- 1.1.2
- § 10 Abs. 3 wird aufgehoben.
- 1.1.3
- Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:
㤠19a
Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs elektronischer Wasserzähler
(1) Die Gemeinde setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt diese.
(2) Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte oder ausgelesene personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Die im Wasserzähler vor Ort gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens nach zwei Jahren zu löschen, die ausgelesenen personenbezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren.
(3) Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion betrieben werden, werden von einem Beauftragten der Gemeinde möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner selbst ausgelesen. Ihre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers. Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.“
- 1.2
- In Anlage 2 wird nach Nr. 9 folgende Nr. 10 angefügt:
„10.Elektronische Wasserzähler
(zu § 19a)
- 10.1
- Im Zuge der Anpassung des bayerischen Rechts an die Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) durch das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230, BayRS 204-1-I) ist in Art. 24 GO ein neuer vierter Absatz aufgenommen worden (vgl. Art. 39b Abs. 3 Nr. 2 BayDSG), der den Einsatz elektronischer Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul gesetzlich regelt.
Vor dem Hintergrund des Vorbehalts des Gesetzes war eine gesetzliche Ordnung dieses Bereichs insbesondere mit Blick auf den Einsatz elektronischer Wasserzähler mit Funkmodul geboten, da dieser verschiedene Grundrechte berühren kann, namentlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung.
- 10.2
- Art. 24 Abs. 4 Satz 1 GO ermächtigt die Gemeinden, elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul durch Satzung zuzulassen. Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GO enthält unmittelbar anwendbare gesetzliche Vorgaben in Bezug auf die Verarbeitung der von elektronischen Wasserzählern erhobenen und gespeicherten Daten. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 bis 7 GO regelt ein spezifisches, gegen die Verwendung der Funkfunktion eines elektronischen Wasserzählers gerichtetes Widerspruchsrecht.
Von den landesrechtlichen Vorgaben bleiben die allgemeinen datenschutzrechtlichen Verarbeitungsanforderungen nach den Kapiteln III und IV der DSGVO unberührt. Dies betrifft insbesondere das allgemeine datenschutzrechtliche Widerspruchsrecht aus Art. 21 DSGVO (siehe dazu Nr. 10.6.9), außerdem zum Beispiel die Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 DSGVO. Ebenfalls unberührt bleiben die datenschutzrechtlichen Grundsätze des Kapitels II der DSGVO. So ist etwa der Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO) ergänzend zu den Vorgaben des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GO zu beachten. Dasselbe gilt für den Grundsatz der Datensicherheit aus Art. 5 Abs. 1 Buchst. f DSGVO.
§ 19a WAS ist eine den § 19 WAS ergänzende Regelung für den Einsatz und Betrieb elektronischer Wasserzähler. Auch für elektronische Wasserzähler (mit und ohne Funkmodul) gelten daher die Maßgaben des § 19 WAS, soweit § 19a WAS keine abweichende Regelung trifft. Eine Aufnahme des § 19a WAS in die gemeindliche Satzung ist allerdings nur geboten, falls eine Gemeinde von der Ermächtigungsgrundlage des Art. 24 Abs. 4 Satz 1 GO tatsächlich Gebrauch machen und elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul einsetzen und betreiben will.
§ 19a Abs. 1 WAS macht zunächst von der Ermächtigung in Art. 24 Abs. 4 Satz 1 GO Gebrauch. Da Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO unmittelbar anwendbares Gesetzesrecht ist, ist eine Wiederholung der Regelungsinhalte in der Satzung nicht erforderlich. Die Gemeinden könnten die Regelungen des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO jedoch klarstellend in ihre Satzungen aufnehmen, etwa im Hinblick auf eine Vereinfachung des Verwaltungsvollzugs oder der Bürgerfreundlichkeit wegen.
§ 19a Abs. 2 WAS regelt Löschungsfristen, die vor allem den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Art. 6 DSGVO Rechnung tragen sollen. Satz 1 spiegelt sowohl für vor Ort im Wasserzähler gespeicherte als auch für ausgelesene, also bereits beim Wasserversorger gespeicherte personenbezogene Daten den allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit. Darüber hinaus gibt § 19a Abs. 2 Satz 2 Höchstfristen für die Löschung vor. Vor Ort im Wasserzähler gespeicherte personenbezogene Daten sind spätestens nach zwei Jahren zu löschen; ausgelesene, also bereits beim Wasserversorger gespeicherte personenbezogene Daten spätestens nach fünf Jahren.
§ 19a Abs. 3 WAS orientiert sich an der Regelung zur Ablesung des § 19 Abs. 4 WAS, passt sie aber an die Rechtslage bezüglich elektronischer Wasserzähler an.
- 10.3
- Zur Frage, in welchen zeitlichen Intervallen elektronische Wasserzähler Daten unter Verwendung ihres Funkmoduls übertragen dürfen, lässt sich Folgendes sagen:
- 10.3.1
- Art. 24 Abs. 4 Satz 3 GO beschreibt die Zwecke, zu denen Daten eines Funkwasserzählers ausgelesen, das heißt an den Wasserversorger übertragen, und von ihm verwendet werden dürfen. Nr. 1 erlaubt dies „zur periodischen Abrechnung oder Zwischenabrechnung des Wasserverbrauchs“. Nr. 2 lässt eine „anlassbezogene“ Übermittlung und Verwendung zu, „soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungseinrichtung und zur Aufklärung von Störungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist.“ Diese Regelungen werden durch den Grundsatz der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO ergänzt, wonach die Menge und der Umfang der verarbeiteten Daten auf das Erforderliche zu beschränken ist. Daraus lassen sich folgende Grundsätze ableiten:
- 10.3.2
- Der Jahreswasserverbrauch ergibt sich aus der Differenz der Zählerstände zu Beginn und am Ende des Abrechnungsjahres. Für die Erstellung der Jahresabrechnung ist ein periodisches autonomes Funken von Zählernummer und Zählerständen über das Jahr hinweg daher nicht erforderlich. Gleiches gilt für andere Abrechnungszeiträume. Der eröffnete Ablesezeitraum ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und entsprechend dem Grundsatz der Datenminimierung möglichst kurz zu halten. Hierbei kann auch ein weiterer unterjähriger Ablesezeitraum vorgesehen werden.
- 10.3.3
- Die Abwehr einer Gefahr für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungseinrichtung und die Aufklärung von Störungen im Wasserversorgungsnetz können es erfordern, Daten – auch in kurzen Intervallen – automatisch zu senden. Dies verlangt einen Anlass im Einzelfall, also einen Hinweis auf eine solche Gefahr oder Störung. Beispielsweise kann ein Funkwasserzähler Daten zu Betriebsausfallzeit, Trockenlauf, Manipulationsversuch, Dauerlauf oder Rückfluss als „Alarmcode“ senden, sobald der Zähler ein solches Ereignis registriert hat. In diesen Fällen kann es dann auch zulässig sein, den Alarmcode – auch in kurzen Intervallen – so lange wiederholt zu senden, bis die Ursache geklärt bzw. die Gefahr für die Wasserversorgungssicherheit und die Trinkwasserhygiene beseitigt ist. Denkbar ist es beispielsweise auch, die Alarmfunkfunktion – etwa durch Funk – erst zu aktivieren, falls in einem bestimmten Versorgungsgebiet ein besonderes Vorkommnis (zum Beispiel eine Leckage) festgestellt wird, und den Zähler dann anlassbezogen engmaschig funken zu lassen, um die (Alarm-)Daten zu erhalten und Gegenmaßnahmen gezielt einleiten zu können. Der Beginn und das Ende der Aktivierung sollte dokumentiert werden.
- 10.3.4
- Funkwasserzähler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des Art. 24 Abs. 4 GO am 25. Mai 2018 bereits im Einsatz waren, senden Daten teils in relativ kurzen Zeitintervallen. Spätestens seit der Gesetzesänderung begegnet der unveränderte Einsatz dieser Funkwasserzähler zwar datenschutzrechtlichen Bedenken. Allerdings ist es in der Regel nicht möglich, die Sendeintervalle anzupassen, da diese Änderungen der technischen Modifikationen grundsätzlich einer erneuten Gerätezulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bedürften. In diesen Fällen sollte Widersprüchen gegen den Einsatz eines Funkwasserzählers unter Verwendung des Funkmoduls – unabhängig von der Frist nach Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO – grundsätzlich abgeholfen und das Funkmodul deaktiviert werden.
- 10.4
- Anhand des unmittelbar kraft Gesetzes geltenden Erforderlichkeitsvorbehalts des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 GO in Verbindung mit seiner Konkretisierung durch Art. 24 Abs. 4 Satz 3 GO ist auch zu beantworten, welche Daten von den Wasserzählern erhoben werden dürfen. Mit Blick auf die Abwicklung der Abrechnung (vgl. Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 GO) ist etwa zu denken an die Zählernummer und den Zählerstand. Geht es um die Lokalisierung von Leckagen (vgl. dazu Nr. 10.3.3), wird man etwa auch die Durchflusswerte zu bestimmten, auch engmaschigeren Zeitpunkten erfassen dürfen.
- 10.5
- Die Maßgaben zur Datenminimierung unter den Nrn. 10.2 bis 10.4 sollten bei künftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden.
- 10.6
- Art. 24 Abs. 4 Satz 5 bis 7 GO regelt ein gegen die Verwendung der Funkfunktion eines elektronischen Wasserzählers gerichtetes Widerspruchsrecht. Die Regelungen sind unmittelbar anwendbares Gesetzesrecht und gelten daher unabhängig davon, ob die Satzung sie inhaltlich wiederholt. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 bis 7 GO tritt neben das Widerspruchsrecht nach der DSGVO (vgl. dazu Nr. 10.6.9).
- 10.6.1
- Kein Widerspruchsrecht besteht gemäß Art. 24 Abs. 4 Satz 7 GO, soweit in einem versorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemeinsamen Wasserzähler haben. In solchen Fällen ist typischerweise kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich. Unter „Einheit“ im Sinne des Art. 24 Abs. 4 Satz 7 GO sind nicht ausschließlich private Wohnungen zu verstehen, sondern auch gewerblich oder anderweitig genutzte Räumlichkeiten mit Wasseranschluss. Typische Beispiele für den Ausschlusstatbestand sind ein mit Wasser versorgtes Mehrfamilienhaus (mehrere Miet- und/oder Eigentumswohnungen) oder auch ein Haus, das gemischt (private Wohnungen und gewerbliche Räume) genutzt wird, und wo jeweils vom Wasserversorger nur ein (gemeinschaftlicher) Wasserzähler angebracht ist.
- 10.6.2
- Gemäß Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO hat die Gemeinde den Gebührenschuldner und den Eigentümer eines versorgten Objekts spätestens drei Wochen vor dem geplanten Einsatz eines Wasserzählers mit Funkmodul auf das Widerspruchsrecht und die Art und Weise seiner Ausübung hinzuweisen. Obgleich widerspruchsberechtigt (vgl. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO), muss also namentlich der Personenkreis der berechtigten Nutzer nicht von der Gemeinde hingewiesen werden. Der Gemeinde bleibt es aber unbenommen, berechtigte Nutzer gleichwohl – ohne rechtliche Verpflichtung – auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen. Die Frage, ob ein Vermieter den Mieter des versorgten Objekts – etwa als Nebenpflicht im Rahmen des Mietvertrags – auf dessen Widerspruchsrecht hinweisen muss, richtet sich ausschließlich nach Zivilrecht.
Bei der genannten Frist handelt es sich um eine Ereignisfrist, deren Berechnung sich nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (vgl. § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Variante 1 BGB) richtet.
In formaler Hinsicht muss der Hinweis in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form erfolgen. Dies zieht unter anderem nach sich, dass der Hinweis zwar mit dem Hinweis nach Art. 21 Abs. 4 DSGVO auf das Widerspruchsrecht nach der DSGVO – der im Übrigen ebenfalls von anderen Informationen getrennt zu erfolgen hat – in einem Dokument verknüpft werden könnte, er von jenem Hinweis aber textlich abgegrenzt erscheinen müsste. Mangels anderweitiger gesetzlicher Regelung kann außerdem der Hinweis nur individualisiert erfolgen; insbesondere eine öffentliche Bekanntmachung würde den Anforderungen des Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO nicht gerecht. Allerdings sind die Gemeinden nicht gehindert, den Hinweis zusätzlich öffentlich bekannt zu machen; unmittelbare Rechtsfolgen mit Blick auf das Widerspruchsrecht, insbesondere eine Auslösung der Widerspruchsfrist, sind hiermit aber nicht verbunden. Die öffentliche Bekanntmachung ist also allein aus dem Blickwinkel der Bürgerfreundlichkeit zu sehen.
Nur ein ordnungsgemäßer, insbesondere form- und fristgerechter Hinweis löst mit seinem Zugang die zweiwöchige Widerspruchsfrist (vgl. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO) aus. Der Gemeinde obliegt im Streitfall insoweit nach den allgemeinen Regeln die Darlegungs- und Beweislast, sodass sich insoweit entsprechende Vorsorgemaßnahmen zur Dokumentation empfehlen.
- 10.6.3
- Über die gemäß Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO zu Belehrenden (Gebührenschuldner und Eigentümer) hinaus sind auch berechtigte Nutzer des versorgten Objekts widerspruchsberechtigt (vgl. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO).
- 10.6.4
- Jeder der Widerspruchsberechtigten kann sein Recht unabhängig von dem jeweils anderen ausüben (vgl. Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO am Ende; vgl. auch Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO: „Übt einer“).
- 10.6.5
- Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO hat ein Widerspruch schriftlich zu erfolgen.
- 10.6.6
- Vorbehaltlich einer anderen Entscheidung der Gemeinde (siehe Nr. 10.6.8) können sämtliche Widerspruchsberechtigte nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen widersprechen, die mit dem Zugang des ordnungsgemäßen Hinweises der Gemeinde – also (nur) gegenüber dem Eigentümer und dem Gebührenschuldner – zu laufen beginnt. Auch bei dieser Frist handelt es sich um eine Ereignisfrist, deren Berechnung sich nach den Grundsätzen des BGB richtet (vgl. § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Variante 1 BGB). Der Gemeinde obliegt im Streitfall nach den allgemeinen Regeln auch die Darlegungs- und Beweislast bezüglich des fristauslösenden Zugangs eines ordnungsgemäßen Hinweises, sodass sich auch insoweit entsprechende Vorsorgemaßnahmen zur Dokumentation empfehlen.
- 10.6.7
- Bei einem frist- und formgerechten Widerspruch durch eine widerspruchsberechtige Person darf gemäß Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO ein Wasserzähler „nicht unter Verwendung der Funkfunktion betrieben werden.“ Diese Formulierung stellt klar, dass der Widerspruch nicht den Einbau eines Wasserzählers mit Funkmodul schlechthin verhindern kann. Damit bleibt es insbesondere möglich, elektronische Wasserzähler mit Funkmodul grundsätzlich zu verbreiten; erfolgt ein Widerspruch, muss das Funkmodul der Zähler allerdings deaktiviert werden.
- 10.6.8
- Die Gemeinden können entscheiden, ob sie durch eine entsprechende Satzungsregelung ein Widerspruchsrecht einräumen, das über den Mindestinhalt des Widerspruchsrechts nach Art. 24 Abs. 4 Satz 4 bis 7 GO hinausgeht.
- 10.6.9
- Unberührt von dem landesrechtlich geregelten Widerspruchsrecht bleibt das Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Der bayerische Gesetzgeber beabsichtigte mit der Regelung des Art. 24 Abs. 4 Satz 5 bis 7 GO nicht, das Widerspruchsrecht aus der DSGVO auszuschließen oder einzuschränken. Vielmehr wollte er ein vor dem Einbau und der ersten Inbetriebnahme eines Wasserzählers unter Nutzung des Funkmoduls weiter gehendes Widerspruchsrecht gewähren. Beide Widerspruchsrechte unterscheiden sich wie folgt:
Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO muss die widersprechende Person Gründe vorbringen, „die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben“. Das landesrechtliche Widerspruchsrecht ist insofern dagegen voraussetzungslos.
Gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 2 DSGVO führt ein Widerspruch letztlich zu einer Abwägungsentscheidung. Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO gebietet dagegen zwingend die Deaktivierung des Funkmoduls.
Die Widerspruchsrechte unterscheiden sich – abgesehen von den beiden Formulierungsalternativen für einen § 19a Abs. 4 WAS – auch in ihrer zeitlichen Reichweite. Art. 21 Abs. 1 DSGVO geht weiter, weil hiernach jederzeit widersprochen werden kann. Das landesrechtliche Widerspruchsrecht unterliegt nach Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO dagegen einer zweiwöchigen Ausschlussfrist.
- 10.7
- § 19a Abs. 3 WAS übernimmt die in § 19 Abs. 4 WAS enthaltene Regelung mit Blick auf den Einsatz und Betrieb elektronischer Wasserzähler entsprechend.
- 10.8
- Ergänzender Hinweis: Art. 39b Abs. 3 Nr. 3 BayDSG fügt Art. 94 GO einen neuen Absatz 4 an. Er gibt den Gemeinden auf, bei Durchführung der Wasserversorgung auf privatrechtlicher Grundlage oder in Gestalt von sogenannten Betreibermodellen die Grundsätze des Art. 24 Abs. 4 GO zur Geltung zu bringen. Die Vorgaben an die Gemeinden sind je nach Umfang ihrer Beteiligung an einem privatrechtlich organisierten Wasserversorger abgestuft. Der Regelung steht das Anpassungsgebot des § 35 AVBWasserV nicht entgegen, weil die AVBWasserV keine spezifischen Vorgaben zu dem Einsatz und Betrieb elektronischer Wasserzähler enthält.“
- 2.
- Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 2019 in Kraft.
Günter Schuster
Ministerialdirektor