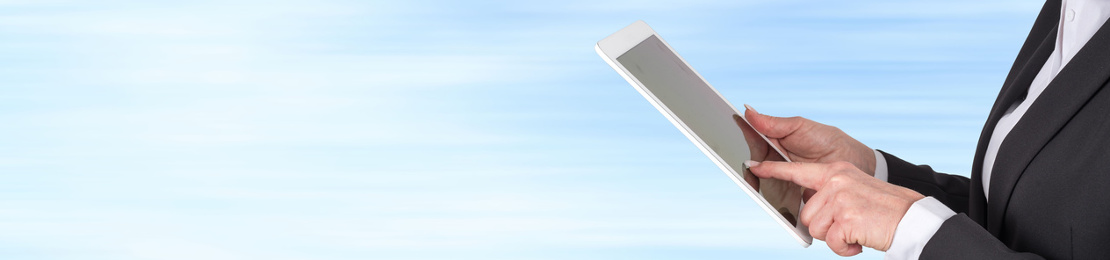2126-1-19-G
Begründung der Verordnung zur Änderung der Fünfzehnten
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
vom 16. Februar 2022
Die Begründung der Verordnung zur Änderung der Fünfzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) vom 16. Februar 2022 (BayMBl. Nr. 115) wird im Hinblick auf § 28a Abs. 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bekannt gemacht.
Die vorliegende Verordnung beruht auf § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1, §§ 28a, 28c IfSG in Verbindung mit § 7 SchAusnahmV und § 9 Nr. 5 DelV.
Durch die vorliegende Verordnung werden Erleichterungen bei den Maßnahmen der 15. BayIfSMV vorgenommen.
Soweit in der 15. BayIfSMV bereits bestehende Maßnahmen fortgeführt werden, wird auf die Begründung der 14. BayIfSMV vom 1. September 2021 (BayMBl. Nr. 616) sowie auf die Begründungen der Verordnungen zur Änderung der 14. BayIfSMV vom 15. September 2021 (BayMBl. Nr. 662), vom 30. September 2021 (BayMBl. Nr. 711), vom 5. Oktober 2021 (BayMBl. Nr. 716), vom 14. Oktober 2021 (BayMBl. Nr. 734), vom 27. Oktober 2021 (BayMBl. Nr. 758), vom 5. November 2021 (BayMBl. Nr. 773), vom 9. November 2021 (BayMBl. Nr. 777), vom 15. November 2021 (BayMBl. Nr. 797) und vom 16. November 2021 (BayMBl. Nr. 800), auf die Begründung der 15. BayIfSMV vom 23. November 2021 (BayMBl. Nr. 827) sowie auf die Begründungen der Verordnungen zur Änderung der 15. BayIfSMV vom 3. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 842), vom 10. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 869), vom 14. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 876), vom 23. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 950), vom 11. Januar 2022 (BayMBl. Nr. 3), vom 13. Januar 2022 (BayMBl. Nr. 37), vom 17. Januar 2022 (BayMBl. Nr. 42), vom 26. Januar 2022 (BayMBl. Nr. 68) sowie vom 8. Februar 2022 (BayMBl. Nr. 90) verwiesen.
Deutschland und Bayern befinden sich mit der dominanten Zirkulation der Variante Omikron in der fünften Welle der Corona-Pandemie. Auch wenn sich die Infektionszahlen weiterhin auf einem hohen Niveau befinden, deutet die Entwicklung der vergangenen Tage darauf hin, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht und möglicherweise bereits überschritten hat. Die Infektionszahlen sind stabil und mittlerweile auch rückläufig. Auch der Expertenrat der Bundesregierung geht in seiner aktuellen Stellungnahme vom 13. Februar 2022 davon aus, dass der Anstieg der Zahlen in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen wird. In der Folge werde erwartet, dass sich die Welle abflache und die Zahl der Neuinfektionen mit der Omikron-Variante sinke. Diese Variante ist zwar deutlich stärker übertragbar als die früheren Varianten. Gleichzeitig deuten wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen in anderen Ländern darauf hin, dass schwere Erkrankungen, Hospitalisierungen und Intensivbehandlungen bei einer Infektion mit Omikron weniger häufig sind, als bei der Delta-Variante. Daher sind neben der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auch diese Parameter zur Beurteilung der Belastung des Gesundheitssystems von zentraler Bedeutung. Derzeit ist dabei insbesondere eine Entkoppelung der Inzidenzen von der Krankenhausbelastung festzustellen. Aufgrund der aktuellen Situation sind daher weitere Anpassungen der Infektionsschutzmaßnahmen möglich.
Das maßgebliche Lagebild für die vorliegende Verordnung stellt sich wie folgt dar:
Nach dem starken Anstieg der Meldefälle, der ab dem Jahreswechsel zu beobachten war, zeichnet sich seit 10. Februar 2022 eine Stagnation der täglichen Fallzahlen ab. Am 15. Februar 2022 lag die 7-Tage-Inzidenz der Meldefälle in Bayern bei 1 783,3. Damit wies Bayern am 15. Februar 2022 eine 7-Tage-Inzidenz über dem Bundesdurchschnitt von 1 437,5 auf.
Insgesamt verzeichneten nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am 15. Februar 2022 95 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern eine 7-Tage-Inzidenz der Meldefälle von über 900. Im Einzelnen liegen 93 Landkreise und kreisfreie Städte über 1 000, davon 26 Kreise zwischen 2 000 und 3 000. Ein weiterer Kreis liegt zwischen 500 und 600 (https://experience.arcgis.com/
Die Reproduktionszahl lag in den vergangenen Tagen unter dem Wert von 1. Nach RKI-Berechnungen lag der 7-Tage-R-Wert für Bayern am 15. Februar 2022 bei 0,87, für Deutschland bei 0,88.
In der Kalenderwoche 6 (7. Februar bis 13. Februar 2022) wurden insgesamt 209 Sterbefälle gemeldet. Dies entspricht damit annähernd dem Wert der Vorwoche (31. Januar bis 6. Februar 2022) mit 202 Sterbefällen.
Die 7-Tage-Hospitalisierungsrate als Maßstab für die Krankheitsschwere ist in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Am 15. Februar 2022 wurden nach den Daten des LGL innerhalb der letzten sieben Tage 696 hospitalisierte Fälle registriert, was einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 5,30 entspricht (https://www.lgl.bayern.de/
Die oben genannte Hospitalisierungsinzidenz ist aktuell jedoch nicht hinreichend valide, weil es aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen zu erheblichen Meldeverzügen der Gesundheitsämter kommt. Das RKI weist deshalb eine adjustierte 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz aus, die den zeitlichen Verzug der Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz korrigiert (https://www.rki.de/DE/
Seit dem 15. Januar 2022 liegt die adjustierte 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wieder über dem vom RKI im Papier zur ControlCOVID-Strategie für die Stufe Rot empfohlenen Grenzwert von 5 (https://www.rki.de/DE/
Seit dem 16. Januar 2022 ist bei zunächst leichten Schwankungen in den Tagesverläufen ein inzwischen deutlicher Anstieg der Zahl stationär behandelter COVID-19-Patienten insgesamt zu beobachten. Im Bereich der Intensivbetten ist in Anbetracht der seit dem 24. Januar 2022 deutlich schwankenden Entwicklung zwar noch kein eindeutiger Trend erkennbar, allerdings zeichnet sich eher eine weitere Zunahme der Intensivbettenbelegung durch COVID-19-Patienten ab. Aktuell werden bayernweit 3 587 Patienten, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, stationär behandelt (Meldungen der Krankenhäuser in IVENA vom 15. Februar 2022). 376 COVID-19-Fälle werden derzeit intensivmedizinisch behandelt (Meldungen der Krankenhäuser im DIVI-Intensivregister vom 15. Februar 2022). Die durchschnittliche Auslastung der Intensivstationen liegt bei 87,7 % (DIVI-Meldungen, Stand 15. Februar 2022). In 32 von 96 kreisfreien Städten bzw. Landkreisen weisen die Intensivstationen der Kliniken eine Auslastung von weniger als 80 % auf. In 17 kreisfreien Städten bzw. Landkreisen liegt die Auslastung hingegen über 95 %, davon in 15 kreisfreien Städten bzw. Landkreisen bei 100 %. Auf Ebene der Integrierten Leitstellen (ILS) liegt bei fünf der insgesamt 26 ILS die Auslastung der Intensivkapazitäten unter 80 %, eine ILS weist eine Auslastung von über 95 % auf (DIVI-Meldungen, Stand 15. Februar 2022). Das sind 44 mehr als noch vor einer Woche.
Neben den Patientenzahlen ist dabei auch die Verfügbarkeit von Personal für die weitere Lagebeurteilung von entscheidender Bedeutung. So wird das System umso stärker belastet, je stärker sich die zu verzeichnenden Personalausfälle, etwa infolge von Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen, darstellen. Durch die Änderung der Allgemeinverfügung zur Bewältigung erheblicher Patientenzahlen im Krankenhaus vom 16. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 903) und insbesondere einer Anpassung der Allgemeinverfügung zur Quarantäne von Kontaktpersonen und von Verdachtspersonen von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) wurde hierfür entsprechende Vorsorge getroffen. Dadurch wurde u. a. die Möglichkeit geschaffen, geeignetes Personal von Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation an Krankenhäuser abzuordnen. Zudem ist es möglich, in besonderen Ausnahmefällen auch geeignete psychiatrische Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit somatischen Erkrankungen heranzuziehen.
Momentan können die Krankenhäuser die durch die Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 bedingte Inanspruchnahme von stationären Behandlungsleistungen auf Intensiv- wie auf Normalstationen, auch unter Berücksichtigung von Personalausfällen aufgrund Isolation bzw. Quarantäne, noch hinreichend bewältigen.
Angesichts des nach wie vor vergleichsweise hohen Niveaus der Intensivbettenbelegung insgesamt (COVID-19- und Non-COVID-19-Patienten) und der in den letzten Tagen festzustellenden Zunahme der COVID-19-Patienten auf Normalstationen ist die aktuelle Entwicklung der Hospitalisierung von COVID-19-Patienten sowie der Personalsituation aber auch weiterhin aufmerksam zu beobachten.
Die bis zum 23. Januar 2022 rückläufige Entwicklung hinsichtlich der Belegung mit COVID-19-Patienten auf Intensivstationen sowie die Tatsache, dass trotz der äußerst hohen Inzidenzen momentan noch kein eindeutiger Trend zu einem deutlichen Anstieg der Intensivbettenbelegungen mit Omikron-Patienten erkennbar ist, hat insgesamt jedoch gezeigt, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.
In Bayern wurden bisher 25 915 127 COVID-19-Schutzimpfungen durchgeführt, die sich auf Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen verteilen. Inzwischen (Stand 15. Februar 2022) haben bereits 9 697 530 Personen, und damit rund 73,8 %, eine Grundimmunisierung durch Impfung(en) erhalten. Die Impfquote der grundimmunisierten Personen ab 60 Jahren liegt in Bayern bei rund 86,4 %, die Impfquote der grundimmunisierten Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren liegt bei rund 81,8 % und die Impfquote der grundimmunisierten Personen im Alter von 12 bis 17 Jahren bei 62,8 %. Seit Mitte August 2021 besteht für bestimmte Personengruppen die Möglichkeit, eine Auffrischungsimpfung zu erhalten. Seit Mitte November 2021 können grundsätzlich alle Volljährigen und seit Mitte Januar 2022 auch alle 12- bis 17-Jährigen eine Auffrischungsimpfung erhalten, sofern der Mindestabstand zur vollständigen Impfung abgelaufen ist. In Bayern wurden bisher 7 042 526 Auffrischungsimpfungen durchgeführt, die in der oben genannten Gesamtzahl der COVID-19-Schutzimpfungen enthalten sind. Die Impfquote bei den Auffrischungsimpfungen liegt damit bezogen auf die bayerische Bevölkerung derzeit bei rund 53,6 %.
Da ausreichend Impfstoff für COVID-19-Schutzimpfungen vorhanden ist, besteht seit vielen Wochen für alle Impfwilligen ab 12 Jahren die Möglichkeit, zeitnah eine Schutzimpfung zu erhalten. Der Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer für Fünf- bis Elfjährige wurde am 26. November 2021 von der Europäischen Kommission zugelassen. Die ersten Impfungen erfolgten Mitte Dezember 2021. Inzwischen liegt die Impfquote bei den Erstimpfungen bezogen auf die bayerische Bevölkerung dieser Altersgruppe bei rund 19,6 % und bei den vollständigen Impfungen bei rund 14,4 %.
Es gibt zwar Hinweise auf eine reduzierte Schutzwirkung und insbesondere Dauer des Impfschutzes gegen die Omikron-Variante. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass insbesondere eine Auffrischungsimpfung nach Grundimmunisierung den Immunschutz substantiell verbessert und vor Infektionen und insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Für die Senkung der Neuinfektionen, den Schutz der Risikogruppen und die Minimierung von schweren COVID-19-Erkrankungen und damit auch die Begrenzung der Belastung des Gesundheitssystems ist die Impfung der Bevölkerung von zentraler Bedeutung.
Das Ziel der infektionspräventiven Maßnahmen ist es weiterhin, den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu minimieren und das Gesundheitswesen zu entlasten. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Vermeidung von Langzeitfolgen, die auch nach milden Krankheitsverläufen auftreten können und deren langfristige Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Daher sollten von jedem Bürger und jeder Bürgerin möglichst alle anwendbaren Maßnahmen des Infektionsschutzes umgesetzt werden: die Kontaktreduktion, die Einhaltung des Mindestabstands, die Beachtung der Hygiene, das Tragen von Masken sowie das regelmäßige und gründliche Lüften von Innenräumen vor, während und nach dem Aufenthalt mehrerer Personen (AHA+L Regeln). Diese Empfehlungen gelten auch für Geimpfte und Genesene, da Infektionen und Transmissionen auch in diesen Personengruppen auftreten können.
Vor dem Hintergrund dieses Lagebilds sind mit Blick auf die eingangs dargestellten Unterschiede von Krankheitsverläufen bei Infektionen mit der Omikron-Variante gegenüber Krankheitsverläufen bei Infektionen mit dem Wildtyp von SARS-CoV-2 oder den zuvor dominierenden Varianten folgende Anpassungen der Maßnahmen der 15. BayIfSMV geboten:
Die aktuelle infektiologische Lage ermöglicht vorsichtige Anpassungen. Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG sind die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Es ist deshalb geboten, die bislang erforderlichen Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens in Bayern im bestimmten Umfang zurückzunehmen.
Durch die Streichung von § 3 Abs. 2 werden die allgemeinen Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder unter 14 Jahren teilnehmen, aufgehoben. Für private Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken, an denen Personen teilnehmen, die nicht im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder noch nicht 14 Jahre alt sind, bleibt es bei der bisherigen Regelung des § 3 Abs. 1. Hier sind Zusammenkünfte weiterhin nur zwischen den Mitgliedern eines Hausstands und bis zu zwei Personen eines weiteren Hausstands möglich. Für private Veranstaltungen in nichtprivaten Räumlichkeiten sowie unter freiem Himmel auf nichtprivaten Grundstücken gelten weiterhin die nunmehr in § 4 geregelten Bestimmungen für Veranstaltungen.
Durch die Neufassung der §§ 4 und 5 und die Streichung der §§ 4a und 5a werden insbesondere die Zugangsvoraussetzungen neu geregelt. Ein 2G plus-Erfordernis sieht die Verordnung nicht mehr vor. In den Lebensbereichen, in denen bislang 2G plus galt, finden stattdessen größtenteils 2G-, zum Teil aber auch 3G-Regelungen Anwendung.
Die Vorschrift des Absatzes 1 von § 4 regelt nunmehr die Bereiche, in denen die 2G-Regel, aber keine umfassende Kapazitätsbeschränkung gilt. Betroffen ist gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, wie bereits bislang nach § 5 Abs. 1 und § 11 Nr. 1, der Zugang sowohl zur Gastronomie in geschlossenen Räumen als auch zur Außengastronomie. Dem 2G-Erfordernis unterliegt darüber hinaus nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Zugang zu geschlossenen Räumen im Beherbergungswesen und zu Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen. Sowohl für das Beherbergungswesen als auch für die Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen gilt das 2G-Erfordernis somit, wie bereits bislang, nur für den Zugang zu geschlossenen Räumen, während unter freiem Himmel der Zugang auch Personen möglich ist, die weder geimpft noch genesen sind.
Schließlich wird durch § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Zugang zu zoologischen und botanischen Gärten, Gedenkstätten, Freizeitparks, Ausflugsschiffen außerhalb des Linienverkehrs und Führungen dem 2G-Erfordernis unterstellt. Zu den Führungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zählen nicht museumspädagogische Vermittlungsangebote, Führungen und vergleichbare Bildungsangebote der Museen. Diese unterfallen der spezielleren Regelung des neuen § 5 Abs. 2 und damit einem 3G-Erfordernis.
Für die in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Einrichtungen und Veranstaltungen bestehen keine allgemeinen Kapazitätsbeschränkungen nach § 4. Finden in diesen Einrichtungen aber speziellere Veranstaltungen statt, die einer Kapazitätsbeschränkung unterliegen, etwa Tagungen und Kongresse im Veranstaltungsbereich eines Hotels, so gelten die für die spezielleren Veranstaltungen bestehenden Kapazitätsgrenzen. Bei den in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 genannten zoologischen und botanischen Gärten, Gedenkstätten, Freizeitparks, Ausflugsschiffen außerhalb des Linienverkehrs und Führungen besteht eine Kapazitätsbeschränkung in Höhe von 50 % der Kapazität nur für Gebäude und geschlossene Räumlichkeiten, während für diese Einrichtungen und Veranstaltungen unter freiem Himmel keine Kapazitätsbeschränkung gilt.
Die im neuen § 4 Abs. 2 genannten Bereiche unterliegen dem 2G-Erfordernis aus § 4 Abs. 1 und zusätzlich den weiteren Regelungen des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 6. Die absolute Zuschauerobergrenze für Veranstaltungen wird hierbei von 15 000 auf 25 000 erhöht. Seilbahnen unterliegen wie bisher einer Kapazitätsbeschränkung von 75 % nur hinsichtlich geschlossener Kabinen. Wie bisher gilt diese Kapazitätsgrenze für geschlossene Kabinen von Seilbahnen mit Blick auf das infektiologische Ziel der Regelung nur, soweit Personen aus mehr als einem Hausstand befördert werden. Offene Seilbahnen wie etwa Sessellifte sind, wie bislang, nicht kapazitätsbeschränkt.
Die Neuregelung des § 4 Abs. 3 erlaubt, wie bisher, die Zulassung bestimmter Personen in Abweichung von Abs. 1. Die Vorschrift gilt dabei auch für die Bereiche des Abs. 2, für die in Abs. 2 wiederum auf Abs. 1 verwiesen wird. Die Regelung erlaubt unter anderem minderjährigen Schülerinnen und Schülern, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden, den Zugang zu allen 2G-Bereichen auch ohne geimpft oder genesen zu sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 2).
Nach § 4 Abs. 4 gilt für Anbieter, Veranstalter, Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige der von Absatz 1 erfassten Betriebe und Veranstaltungen mit Kundenkontakt § 28b Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes entsprechend. Als „von Absatz 1 erfasst“ gelten hierbei auch die in § 4 Abs. 2 genannten Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen, da für diese nach § 4 Abs. 2 Satz 1 die Vorschrift des Absatzes 1 von § 4 entsprechend gilt.
Mit der Neufassung von § 5 werden die Bereiche, die einem 3G-Erfordernis unterfallen, erweitert. Neben dem touristischen Bahn- und Reisebusverkehr sowie den Ausflugsschiffen im Linienverkehr und den körpernahen Dienstleistungen werden gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) im Hinblick auf geschlossene Räume auch Hochschulen, Bibliotheken und Archive, außerschulische Bildungsangebote, einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Erwachsenenbildung, sowie neben den Fahrschulen auch die Musikschulen nunmehr einem 3G-Erfordernis unterstellt. Der Zugang zu diesen Bereichen darf insoweit nur durch Besucher erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind.
Daneben gilt das 3G-Erfordernis nach § 5 Abs. 2 auch für den Zugang zu Museen und Ausstellungen, außerdem für den Zugang zu Sportstätten zur eigenen sportlichen Betätigung und praktischer Sportausbildung und zu Fitnessstudios, während Zuschauer Zugang zu Sportveranstaltungen nur unter 2G-Voraussetzungen erhalten. Schließlich gilt das 3G-Erfordernis nach § 5 Abs. 2 für den Zugang zu Solarien und im Rahmen der eigenen aktiven Mitwirkung in Laienensembles. Für die in § 5 Abs. 2 genannten Bereiche findet zusätzlich § 4 Abs. 2 und damit insbesondere die Kapazitätsgrenzen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 entsprechend Anwendung.
Im Hinblick auf das Testnachweiserfordernis werden die bisherigen Bestimmungen in § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 4 unverändert übernommen. Weiterhin gelten nach § 5 Abs. 5 auch für Anbieter, Veranstalter, Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige der von § 5 erfassten Einrichtungen über den Verweis auf § 4 Abs. 4 die Regelung des § 28b Abs. 1 IfSG sowie über den Verweis auf § 4 Abs. 5 die Pflichten für Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson entsprechend.
Das nunmehrige 3G-Erfordernis der von § 5 neu erfassten Bildungseinrichtungen trägt insbesondere der gewichtigen, grundrechtlich geschützten Bedeutung des Bildungsbereichs Rechnung. Darüber hinaus wird mit dem nunmehrigen 3G-Erfordernis für die eigene sportliche Betätigung und die praktische Sportausbildung in Sportstätten und Fitnessstudios anstelle des bisherigen 2G (plus)-Erfordernisses die besondere Bedeutung des Sports für die Gesunderhaltung bzw. Gesundheitsförderung berücksichtigt.
Das Verbot von Jahresmärkten findet sich nunmehr in § 12 Abs. 1. Die aufgrund des Zusammenkommens einer Vielzahl von Personen mit zahlreichen zusätzlichen Kontakten besonders infektionsgefährdeten Clubs, Diskotheken und Bordellbetriebe, bei denen die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können, bleiben gleichfalls geschlossen.
Die regionalen Hotspot-Lockdown-Regelungen werden aufgehoben. Die Situation im Gesundheitswesen stellt sich weiter als beherrschbar dar; eine Überlastung − und damit die Notwendigkeit der Beibehaltung der regionalen Hotspot-Lockdown-Bestimmungen − droht nicht.
Durch die Änderungen in § 17 werden die erforderlichen Anpassungen der Bußgeldtatbestände vorgenommen. Die weiteren Änderungen sind notwendige Folgeänderungen sowie insbesondere redaktionelle Anpassungen.
§ 2 bestimmt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung. Die Verordnung tritt am 17. Februar 2022 in Kraft.