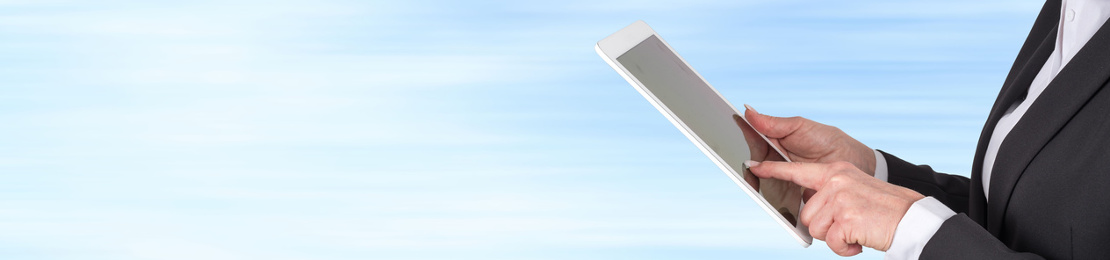7075-A
Richtlinie zur Förderung von Weiterbildungsinitiatorinnen und -initiatoren
zur Qualifizierungsberatung und einer Koordinationsstelle
für den Förderzeitraum von 2025 bis 2027 (WBI-Förderrichtlinie)
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
vom 2. Mai 2024, Az. I2/6021-1/105
1Die Bayerische Staatsregierung hat zur Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und Weiterbildungsbeteiligung ein Angebot sogenannter Weiterbildungsinitiatoren und Weiterbildungsinitiatorinnen (WBI) etabliert und einen Koordinator oder eine Koordinatorin für die WBI eingesetzt (WBI-K). 2Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere der Verwaltungsvorschriften zu den Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung – BayHO, einschließlich der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P – und für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften – ANBest-K) Zuwendungen zur Förderung des Einsatzes von WBI und eines oder einer WBI-K. 3Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 4Die Entscheidung über die Gewährung der Zuwendungsbewilligung wird nach pflichtgemäßem Ermessen getroffen.
Teil 1 Allgemeine Beschreibung des Zuwendungsbereichs
1.Zweck der Zuwendung
1Die Arbeitswelt verändert sich insbesondere angesichts der Dekarbonisierung sowie des digitalen und demografischen Wandels grundlegend. 2Die sogenannte 3D-Transformation, allen voran die Digitalisierung der Wirtschaft, verlangt den Beschäftigten und Unternehmen neue Kompetenzen ab. 3Eine stetige Anpassung an die qualifikatorischen Anforderungen der Arbeitswelt ist zudem wegen des steigenden Fachkräftebedarfs erforderlich, um Passungsprobleme zu vermeiden und das gesamte Fachkräftepotenzial auszuschöpfen. 4Ziel der Förderung ist deshalb, Beschäftigte und Unternehmen in Bayern durch eine niederschwellige und regionale Beratungsstruktur zu unterstützen, um
- die Weiterbildungsbereitschaft dieser nachhaltig zu erhöhen und
- durch mehr berufliche Weiterbildung die Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Bayern zu erhalten und auszubauen.
5Die gezielte Beratung und Sensibilisierung aller Beteiligten zum Thema berufliche Weiterbildung erfolgen in adäquater Ergänzung zum gesetzlichen Angebot der Arbeitsverwaltung.
1.1Aufgaben der WBI
1.1.1Qualitative Ziele
1Die WBI zeigen die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für Beschäftigte und Unternehmen auf, indem sie
- Weiterbildungsbedarfe in Abstimmung mit Beschäftigten sowie Unternehmen unmittelbar „vor Ort“ und unter Einbezug betrieblicher Erfordernisse und der Arbeitnehmerinteressen feststellen,
- bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen und Vermittlung von geeigneten und passgenauen Qualifizierungsmaßnahmen (unter Beachtung des Neutralitätsgebots) sowie der Analyse von Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen,
- mit den Beteiligten individuelle Weiterbildungskonzepte ausarbeiten und initiieren (betrifft unter anderem Art, Bezeichnung und Inhalt der Maßnahme, Zeitraum der Umsetzung, Finanzierung, Eigenbeitrag der jeweiligen Akteure),
- Fördermöglichkeiten von Seiten der Bundesagentur für Arbeit, der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes darstellen,
- gegebenenfalls zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung geschaffene Fördermittel des Freistaats Bayern ausgeben,
- die Unternehmen auch unter Einbezug der Interessens- und Arbeitgebervertretungen dazu motivieren, die Beschäftigten nach der Weiterbildung möglichst qualifizierungsadäquat zu beschäftigen,
- die Weiterbildung in der Umsetzung – soweit erforderlich und gewünscht – bis zum Schluss motivierend begleiten,
- intensiv mit dem oder der WBI-K zusammenarbeiten (siehe hierzu Nr. 1.2),
- die Informationsarbeit des StMAS zum Thema berufliche Weiterbildung über das Weiterbildungsportal www.kommweiter.bayern.de unterstützen und
- Netzwerkarbeit unter anderem mit folgenden Akteuren leisten: Unternehmen, Beschäftigten, Arbeitsagenturen, Jobcentern, Kammern, Anerkennungsberatung, Gewerkschaften, gegebenenfalls mit Betriebs- und Personalräten sowie regionalen Bildungsträgern.
2Die WBI bieten eine nichtwirtschaftliche Beratungstätigkeit an, die Beschäftigten und Unternehmen aus sämtlichen Branchen offensteht. 3Eine partnerschaftliche Abstimmung mit den Agenturen für Arbeit und deren Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatungsangeboten sowie weiteren bestehenden Beratungsmöglichkeiten vor Ort ist erforderlich. 4Die Vorschriften des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) sind zu beachten.
1.1.2Quantitative Ziele
Um eine nachhaltige Erfüllung der unter Nr. 1.1.1 genannten Aufgaben zu erzielen, soll der oder die einzelne WBI die folgenden quantitativen Vorgaben erfüllen:
- 1.1.2.1
- 1Der oder die WBI führt pro Halbjahr mindestens 40 Erstgespräche mit Unternehmen. 2Als Erstgespräch ist ein über eine bloße Kontaktaufnahme hinausgehender initialer Austausch zu verstehen. 3Aus den Erstgesprächen ergeben sich längerfristige Kontakte mit dem Ziel einer vertieften Betreuung/Beratung, so dass zusätzlich zu den Erstgesprächen pro Halbjahr mindestens 20 Folgegespräche bezüglich betrieblicher Weiterbildung geführt werden. 4Einseitige Projektverfolgungen eines oder einer WBI sind keine Folgegespräche.
- 1.1.2.2
- 1Der oder die WBI führt pro Halbjahr mindestens 60 Erstgespräche mit Beschäftigten. 2Als Erstgespräch ist ein über eine bloße Kontaktaufnahme hinausgehender initialer Austausch zu verstehen. 3Aus diesen Erstgesprächen ergeben sich längerfristige Kontakte mit dem Ziel einer vertieften Betreuung/Beratung, so dass zusätzlich zu den Erstgesprächen pro Halbjahr mindestens 30 Folgegespräche bezüglich individueller Weiterbildung geführt werden. 4Einseitige Projektverfolgungen eines oder einer WBI sind keine Folgegespräche. 5Ziel der Beratung eines oder einer Beschäftigten ist es, diesem oder dieser eine konkrete Weiterbildungsmöglichkeit aufzuzeigen.
- 1.1.2.3
- 1Im Rahmen der Folgegespräche erarbeitet der oder die WBI pro Halbjahr mindestens zehn schriftlich festgehaltene Weiterbildungskonzepte (siehe Nr. 1.1.1) für individuelle Weiterbildung und mindestens vier schriftlich festgehaltene Weiterbildungskonzepte für betriebliche Weiterbildung und begleitet deren Umsetzung. 2Auf Grundlage der in dem jeweiligen Halbjahr erarbeiteten Weiterbildungskonzepte erstellt der oder die WBI im Rahmen der projektbezogenen Erfolgskontrolle (siehe Nr. 9) jeweils einen „Best-Practice“-Bericht. 3Dieser soll fünf individuelle und zwei betriebliche Weiterbildungskonzepte beinhalten, welche besonders hervorzuheben sind, und diese ausführlich beschreiben.
- 1.1.2.4
- Der oder die WBI betreibt Öffentlichkeitsarbeit in der Region mit mindestens fünf Publikationen im Kalenderjahr (zum Beispiel durch Printmedien, lokalen Rundfunk, soziale Medien).
- 1.1.2.5
- Der oder die WBI nimmt pro Kalenderjahr an mindestens drei regionalen Veranstaltungen zum Zwecke der Netzwerkarbeit teil (Messen, Konferenzen, etc.).
- 1.1.2.6
- 1Der oder die WBI initiiert und organisiert im Kalenderjahr mindestens eine regionale Veranstaltung zum Zwecke der Netzwerkarbeit selbst. 2Es liegt keine solche Veranstaltung vor, wenn der oder die WBI an einer Veranstaltung teilnimmt und in diesem Rahmen einen organisatorischen Anteil übernimmt.
- 1.1.2.7
- Der oder die WBI nimmt grundsätzlich an den in jedem Quartal stattfindenden Netzwerktreffen der WBI teil.
- 1.1.2.8
- Weitere Einzelheiten zur Erreichung der quantitativen Ziele kann das StMAS in den Vorgaben zur projektbezogenen Erfolgskontrolle festlegen (siehe Nr. 9).
1.2Aufgaben des/der WBI-K
1.2.1Qualitative Ziele
1Um die Arbeit der in Bayern eingesetzten WBI gezielt zu steuern, bedarf es einer zentralen Stelle. 2Der oder die WBI-K hat folgende Aufgaben:
- Koordination und Steuerung der eingesetzten WBI in engem Austausch mit dem StMAS,
- Förderung der Netzwerkarbeit der WBI untereinander durch Organisation regelmäßiger Netzwerktreffen,
- Qualitätssicherung der Arbeit der WBI durch Workshops und weitere Maßnahmen in engem Austausch mit dem StMAS (zum Beispiel Erstellung, Weiterentwicklung und bedarfsorientierte Prüfung der Nutzung von Arbeitshilfen und Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung der „Best-Practice“-Berichte für alle WBI),
- First-Level-Support für Anliegen der WBI,
- Gegebenenfalls Feststellung von Schulungsbedarf und Organisation entsprechender Maßnahmen in Abstimmung mit dem StMAS,
- Koordinierende Kontaktperson für interessierte Beschäftigte, Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen,
- Netzwerkarbeit, unter anderem mit folgenden Akteuren: Unternehmen, Beschäftigten, Arbeitsagenturen, Jobcentern, Kammern, Anerkennungsberatung, Gewerkschaften, gegebenenfalls mit Betriebs- und Personalräten sowie regionalen Bildungsträgern,
- Laufende, eigenständige und intensive Beobachtung des Weiterbildungsmarkts inklusive der Förderlandschaft; (wissenschaftlicher) Austausch mit der Leitung der Themenplattform Arbeitswelt 4.0,
- Initiierung von Infoveranstaltungen zum Thema berufliche Weiterbildung (Branchen/Region bezogen oder zu neuen Fördermaßnahmen) in engem Austausch mit dem StMAS,
- Erarbeitung und Weiterentwicklung eines Gesamtkonzepts für die Öffentlichkeitsarbeit der WBI und dessen Umsetzung sowie Controlling in engem Austausch mit dem StMAS. Bindeglied im Austausch zwischen StMAS und WBI bei der Weiterentwicklung des Weiterbildungsportals zur beruflichen Weiterbildung www.kommweiter.bayern.de.
3Der oder die WBI-K bietet eine nichtwirtschaftliche Beratungstätigkeit an, die Beschäftigten und Unternehmen aus sämtlichen Branchen offensteht. 4Eine partnerschaftliche Abstimmung mit den Agenturen für Arbeit und deren Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatungsangeboten sowie weiteren bestehenden Beratungsmöglichkeiten vor Ort ist erforderlich. 5Die Vorschriften des RDG sind zu beachten.
1.2.2Quantitative Ziele
Um eine nachhaltige Erfüllung der unter Nr. 1.2.1 genannten Aufgaben zu erzielen, soll der oder die WBI-K die folgenden quantitativen Vorgaben erfüllen:
- 1.2.2.1
- Der oder die WBI-K organisiert pro Quartal ein Netzwerktreffen der WBI.
- 1.2.2.2
- Der oder die WBI-K bietet zusätzliche Workshops anlassbezogen zu aktuellen, fachlich komplexen Themen an, mindestens aber vier Mal pro Jahr.
- 1.2.2.3
- Der oder die WBI-K nimmt pro Halbjahr an mindestens zwei überregionalen Veranstaltungen zum Zwecke der Netzwerkarbeit teil.
- 1.2.2.4
- 1Der oder die WBI-K initiiert und organisiert im Kalenderjahr mindestens zwei Informationsveranstaltungen, davon mindestens eine überregionale Veranstaltung, zum Zwecke der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit selbst. 2Es liegt keine solche Veranstaltung vor, wenn der oder die WBI-K an einer Veranstaltung teilnimmt und in diesem Rahmen einen organisatorischen Anteil übernimmt.
- 1.2.2.5
- Der oder die WBI-K betreibt überregionale Öffentlichkeitsarbeit mit mindestens zwei bayernweiten Publikationen im Jahr (zum Beispiel durch Printmedien, lokaler Rundfunk, soziale Medien).
- 1.2.2.6
- Weitere Einzelheiten zur Erreichung der quantitativen Ziele kann das StMAS in den Vorgaben zur projektbezogenen Erfolgskontrolle festlegen (siehe Nr. 9).
2.Gegenstand der Förderung
1Gefördert wird im Rahmen des Zuwendungszwecks die Beratungstätigkeit der WBI beziehungsweise des oder der WBI-K zur Erfüllung der unter Nr. 1 beschriebenen Aufgaben. 2Die Beratungstätigkeit der WBI ist jeweils örtlich auf einen der sieben bayerischen Regierungsbezirke zu konzentrieren. 3Es wird eine bayernweite Abdeckung angestrebt, bei der sich mehrere WBI die Zuständigkeit für einen Regierungsbezirk auch untereinander aufteilen können. 4Anträge für das jeweilige Projekt können für eine(n) oder mehrere WBI jeweils mit Angabe des gewünschten Regierungsbezirks eingereicht werden. 5Anträge auf die Förderung des oder der überregional tätigen WBI-K können unabhängig oder zusätzlich zu einem Antrag auf Förderung eines oder einer WBI oder zu Anträgen mehrerer WBI eingereicht werden.
3.Zuwendungsempfänger
1Zuwendungsempfänger sind alle rechtsfähigen Träger, die über die erforderliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zur Durchführung dieser Maßnahmen verfügen. 2Insbesondere müssen die Zuwendungsempfänger über Personal verfügen, welches entsprechend der Anforderungen gemäß Nr. 4 als WBI oder WBI-K eingesetzt werden kann.
4.Zuwendungsvoraussetzungen
1Die WBI und der oder die WBI-K agieren in einem komplexen Umfeld, welches laufenden Änderungen unterworfen ist sowie Flexibilität und Belastbarkeit erfordert. 2Folgende Qualifikationen und Fähigkeiten sind erforderlich:
- (Fach-)Hochschulabschluss oder gleichwertige berufliche Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung (WBI) beziehungsweise abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (WBI-K) und nachgewiesene Kenntnisse im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung,
- Erfahrungen und Kenntnisse in der Weiterbildungsberatung, dem Arbeitsrecht, dem Arbeitsförderungsrecht, dem Förderwesen sowie Kenntnisse der Verwaltungsstrukturen oder die Bereitschaft, sich in diese Themen zügig und intensiv einzuarbeiten,
- Kenntnisse über die Zusammenarbeit der regionalen Arbeitsmarktakteure (Sozialpartnerschaft) und
- hohe Organisationsfähigkeit und Flexibilität, Weiterbildungsbereitschaft, hohe Motivation (insbesondere auch zur Netzwerkarbeit), Teamfähigkeit und Engagement.
5.Art und Umfang der Zuwendung
5.1Art der Förderung
1Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss auf Basis der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. 2Es werden Zuwendungen für Projekte mit einer Laufzeit von drei Jahren gewährt, wobei die Tätigkeit eines oder einer WBI beziehungsweise eines oder einer WBI-K frühestens am 1. Januar 2025 beginnt und entsprechend am 31. Dezember 2027 endet (Regelförderzeitraum). 3Abweichend vom Regelförderzeitraum können auch Zuwendungen für ab dem 1. Januar 2026 beziehungsweise ab dem 1. Januar 2027 beginnende Projekte mit einer Laufzeit von zwei Jahren beziehungsweise von einem Jahr gewährt werden (Projektende ist auch in diesen Fällen der 31. Dezember 2027).
5.2Zuwendungsfähige Ausgaben
Folgende Ausgaben sind förderfähig:
5.2.1WBI
- 1Förderfähig sind projektbezogene Personalausgaben für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Zuwendungsempfängers, der oder die zur Durchführung des Projekts als WBI eingestellt wurde oder für einen vorhandenen Mitarbeiter oder eine vorhandene Mitarbeiterin, der oder die beim Zuwendungsempfänger mit Projektbeginn mit der Beratungstätigkeit als WBI betraut wird. 2Pro WBI-Projekt wird eine Vollzeitstelle (VZÄ) gefördert. 3Die Besetzung ist bei Vorhandensein von zwei Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen (jeweils 50 %), die sich zeitlich und fachlich ergänzen, auch durch zwei WBI für ein Projekt möglich. 4Die Förderfähigkeit der Personalausgaben ist auf den vom StMFH veröffentlichten Personalausgabenhöchstsatz für die Entgeltgruppe E 10 beschränkt. 5Ist das tatsächlich vom Zuwendungsempfänger gezahlte Bruttoentgelt einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, der Umlage zur Zusatzversorgung, der Jahressonderzahlung und der vermögenswirksamen Leistungen niedriger als der Personalausgabenhöchstsatz gemäß Satz 4, ist dieses heranzuziehen. 6Die Förderung entfällt, solange die Stelle nicht besetzt ist oder wegen Krankheit, Elternzeit und Ähnlichem ein tariflicher oder gesetzlicher Entgeltanspruch nicht besteht. 7Über solche Umstände müssen das StMAS und das Zentrum Bayern Familie und Soziales (Bewilligungsbehörde) unverzüglich informiert werden und es ist mitzuteilen, ob und wie der Förderzweck dennoch erreicht werden kann. 8Beratungsleistungen, die nicht dem Zweck dieser Richtlinie entsprechen, sind förderschädlich und führen zu einer Kürzung der Zuwendung.
- 1Direkte Sachausgaben sind im Umfang von höchstens 15 % der förderfähigen Personalausgaben gemäß Spiegelstrich 1, Satz 4 und 5 förderfähig. 2Zu den direkten Sachausgaben zählen:
- Ausgaben für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Rahmen des Projekts stehen und zur Erreichung des Förderzwecks erforderlich sind;
- Reisekosten, die nach dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) in Ansatz gebracht werden;
- Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit und für Veranstaltungen;
- Miet- und Leasingausgaben, für die der Antragsteller tatsächlich Miete entrichtet.
3Sind die tatsächlichen Sachausgaben beim Zuwendungsempfänger niedriger als der Höchstsatz, sind nur die tatsächlichen niedrigeren Sachausgaben heranzuziehen.
5.2.2WBI-K
- 1Förderfähig sind projektbezogene Personalausgaben für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Zuwendungsempfängers, der oder die zur Durchführung des Projekts als WBI-K eingestellt wurde oder für einen vorhandenen Mitarbeiter oder eine vorhandene Mitarbeiterin, der oder die beim Zuwendungsempfänger mit Projektbeginn mit der Koordinierungstätigkeit als WBI-K betraut wird. 2Für den oder die WBI-K wird eine Vollzeitstelle (VZÄ) gefördert. 3Die Besetzung ist auch durch zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen möglich, wenn diese sich zeitlich und fachlich ergänzen. 4Nr. 5.2.1 gilt insofern mit der Maßgabe, dass die Entgeltgruppe E 13 maßgeblich ist, im Übrigen sinngemäß.
- 1Direkte Sachausgaben sind förderfähig. 2Nr. 5.2.1 gilt insofern mit der Maßgabe, dass Sachausgaben im Umfang von höchstens 20 % der förderfähigen Personalausgaben zuwendungsfähig sind, im Übrigen sinngemäß.
5.3Höhe der Förderung
5.3.1Umfang der Förderung
1Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90 % der gemäß Nr. 5.2 ermittelten zuwendungsfähigen Ausgaben. 2Mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben sind vom Zuwendungsempfänger als Eigenmittel aufzubringen.
5.3.2Berücksichtigung von Drittmitteln
1Soweit der Drittmittelgeber mit seiner Zuwendung ausdrücklich die nach dieser Richtlinie nicht zuwendungsfähigen Ausgaben fördert, bleibt diese unberücksichtigt. 2Soweit der Drittmittelgeber mit seiner Zuwendung jedoch ausdrücklich die nach dieser Richtlinie zuwendungsfähigen Ausgaben fördert, so ist die Berücksichtigung von Drittmitteln bis zur Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben abzüglich der Förderung und des angemessenen Eigenmittelanteils gemäß Nr. 5.3.1 unschädlich und führt darüber hinaus zur anteiligen Kürzung der Zuwendung. 3Zweckgebundene Geldspenden Dritter können gemäß VV Nr. 2.4.4 zu Art. 44 BayHO als Eigenmittel eingesetzt werden, wenn sich der Dritte nicht aus eigenem Interesse an der Finanzierung beteiligt oder von Gesetzes wegen zur Leistung verpflichtet ist. 4Die Zuwendung verringert sich nur insoweit, als diese Spenden den festgelegten Eigenanteil überschreiten.
5.3.3Kürzung von Fördermitteln
Sollte der Zuwendungszweck nicht erreicht werden, kann die Bewilligungsbehörde eine prozentual anteilige Reduzierung der Förderung gemäß Nr. 5.3.1 vornehmen.
5.4Mehrfachförderung
Die Förderung von WBI und WBI-K entfällt, soweit für die entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben (siehe Nr. 5.2) anderweitige Mittel des Freistaates Bayern in Anspruch genommen werden.
Teil 2 Verfahren
6.Antragsverfahren
1Alle Anträge nach dieser Richtlinie sind bei der Bewilligungsbehörde unter der Anschrift Zentrum Bayern Familie und Soziales, Team VI4, Hegelstraße 2, 95440 Bayreuth, einzureichen, welches über diese entscheidet. 2Sie sind unter Verwendung der bei der Bewilligungsbehörde erhältlichen Vordrucke zu erstellen (https://www.zbfs.bayern.de/
7.Bewilligungsverfahren
1Auf Grundlage des Antrags erlässt die Bewilligungsbehörde einen Bewilligungsbescheid. 2Auf Antrag kann die Bewilligungsbehörde bei Vorliegen der Voraussetzungen der VV Nr. 1.3.3 zu Art. 44 BayHO die Einwilligung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilen.
8.Kommunikation
Im Rahmen von Veröffentlichungen und in öffentlicher Kommunikation im Zusammenhang mit dem Förderprogramm sowie in direkter Kommunikation mit Antragstellern ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Zuwendungen aus dem Programm freiwillige Leistungen darstellen und nur insoweit bewilligt werden können, als dafür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, und deshalb ein Zuwendungsantrag unter Umständen wegen Überzeichnung des Förderprogramms nicht bewilligt werden kann.
9.Projektbezogene Erfolgskontrolle (Controlling)
1Zur Durchführung der projektbezogenen Erfolgskontrolle sind die WBI beziehungsweise der oder die WBI-K verpflichtet, aktuelle Daten zu ihrer Beratungs- oder Koordinationstätigkeit zu erheben und dem StMAS zum Ende jeden Halbjahres zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. 2Einzelheiten zur Durchführung der projektbezogenen Erfolgskontrolle werden vom StMAS festgelegt. 3In den anderen Bereichen ist der Nachweis der Verwendung gemäß Nr. 10 ausreichend. 4Der Bewilligungsbehörde ist ein Abdruck der projektbezogenen Erfolgskontrolle ausschließlich in digitaler Form zu übersenden.
10.Verwendungsnachweis
1Der Nachweis über die Verwendung der staatlichen Zuwendung für die Förderung von WBI beziehungsweise des oder der WBI-K besteht aus einem Sachbericht inklusive Statistik und einem zahlenmäßigen Nachweis (Verwendungsnachweis). 2Die Bewilligungsbehörde prüft die Verwendungsnachweise in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. 3Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P beziehungsweise ANBest-K ist der Verwendungsnachweis vom jeweiligen Zuwendungsempfänger innerhalb von vier Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des vierten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, vorzulegen. 4Für Zuwendungen im Regelförderzeitraum gemäß Nr. 5.1 Satz 2 ist zusätzlich ein Zwischennachweis in gleicher Form innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des hälftigen Regelförderzeitraums vorzulegen. 5Dem StMAS ist ein Abdruck des Verwendungsnachweises ausschließlich in digitaler Form zu übersenden.
11.Prüfrechte
1Die Bewilligungsbehörde und der Bayerische Oberste Rechnungshof (gemäß Art. 88 und Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayHO) sind zur Prüfung des Vorhabens und der damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen berechtigt. 2Gemäß Art. 91 Abs. 2 Satz 2 BayHO kann sich die Prüfung durch den Bayerischen Obersten Rechnungshof auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zuwendungsempfängers erstrecken. 3Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten, die notwendigen Auskünfte zu erteilen und mitzuwirken.
12.Datenschutz
1Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) einzuhalten. 2Die Bewilligungsbehörde ist Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 3Die Verpflichtungen aus der DSGVO (insbesondere die Betroffenenrechte und die Informationspflichten gemäß Art. 13 f. DSGVO) werden von der Bewilligungsbehörde erfüllt.
13.Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni 2024 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft.
Dr. Markus Gruber
Ministerialdirektor