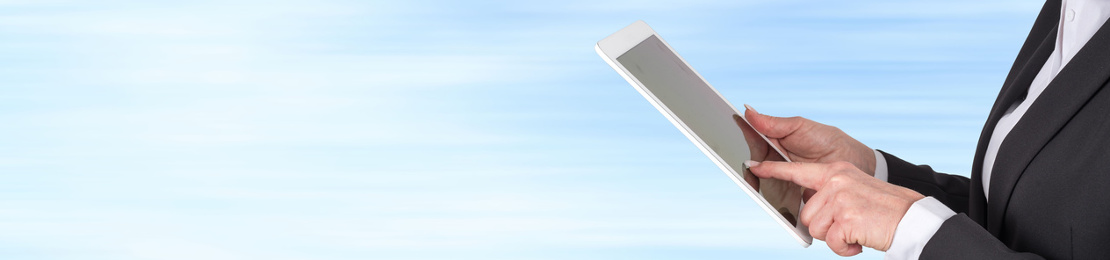2230.1.3-K
„Digitale Schule der Zukunft“ – Lernen mit mobilen Endgeräten
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 31. Mai 2024, Az. I.3-BO1371.2/14/2
1Die „Digitale Schule der Zukunft“ verfolgt das Ziel, Schule und Unterricht in einer Kultur der Digitalität weiterzuentwickeln, um die Schülerinnen und Schüler auf die digitale Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. 2Die technische Grundlage dafür bildet die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten als nicht lernmittelfreie Lernmittel im Sinne des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) im Rahmen einer staatlich bezuschussten Eigenbeschaffung. 3Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) gewährt hierfür den Erziehungsberechtigten bzw. den volljährigen Schülerinnen und Schülern ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen auf der Grundlage der Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), der Verwaltungsvorschriften hierzu sowie nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.
1.Vorteile einer 1:1-Ausstattung mit personenbezogenen mobilen Endgeräten
1Die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie Wirtschaftsschulen mit personenbezogenen mobilen Endgeräten soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen sowie die Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden zu unterstützen. 2Die Umsetzung dieses Ausstattungskonzepts muss daher stets auf eine qualitative Weiterentwicklung des Unterrichts und die systematische Potenzialentfaltung der Schülerinnen und Schüler abzielen, nicht lediglich auf eine quantitative Steigerung des Geräteeinsatzes. 3Die Potenziale des digital gestützten Lernens, die damit in besonderer Weise erschlossen werden sollen, sind insbesondere in nachstehenden Aspekten zu sehen:
- Unterstützung des fachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schüler durch zeitgemäße Lehr- und Lernprozesse (insbesondere durch kollaborative und interaktive Lernaktivitäten),
- erweiterte Förderung von Medienkompetenz (Funktionsweisen und Nutzungsmöglichkeiten digitaler Medien und Werkzeuge kennen, digitale Möglichkeiten effektiv und effizient nutzen und persönliche Nutzungsgewohnheiten kritisch hinterfragen, gesellschaftlich-kulturelle Wirkungen des digitalen Wandels analysieren und reflektieren),
- Verbesserung der Möglichkeiten für Lehrkräfte zur Unterbreitung (automatisiert) differenzierter Lernangebote in diversitätssensiblen Lernumgebungen,
- Steigerung der Motivation und Lernfreude sowie Aktivierung der Lernenden u. a. durch die Stärkung handlungs- und produktionsorientierter Lernsettings,
- Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die digitale Lebens- und Arbeitswelt,
- Verbindung schulischer und außerschulischer Lernorte (seamless learning) sowie Verschmelzung von Klassen- und Onlineräumen (z. B. in einer Lernplattform),
- Verbindung analoger und digitaler Lernsettings durch niederschwellige und flexible, ggf. auch kurzfristige Einsatzmöglichkeiten der mobilen Endgeräte in den Unterrichtsräumen,
- Unterstützung der Kommunikation, Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb einer Schule sowie über die Schule hinaus,
- Unterstützung der Barrierefreiheit und des Zugangs zu Bildungsinhalten, die für Personen mit individuellen Beeinträchtigungen nicht erreichbar wären,
- Nutzung der Multifunktionalität digitaler Endgeräte für die aktive und kreative Medienarbeit,
- verstärkte Einbindung eines digitalen und audio-visuell geprägten Medienrepertoires neben dem (gedruckten) Buch als weiterhin wichtigem Medium der Schule,
- Verbindung formaler und informeller Lernkontexte durch schulische und private Nutzung.
2.Beteiligte Schularten und Schulen
- 2.1
- Staatliche Schulen
Die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten nach dem Modell der bezuschussten Eigenbeschaffung gemäß Nr. 6 und 7 ist ab dem Schuljahr 2024/2025 an staatlichen Schulen folgender Schularten möglich:
- Mittelschulen,
- Realschulen,
- Wirtschaftsschulen,
- Gymnasien,
- Schulen besonderer Art.
- 2.2
- Nichtstaatliche Schulen
Nichtstaatlichen Schulen der unter Nr. 2.1 genannten Schularten sowie Freien Waldorfschulen kann voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/2026 die Beteiligung an der „Digitalen Schule der Zukunft“ eröffnet werden, dann auch – abweichend von Nr. 6.1.2 – (einmalig) mit bis zu vier Jahrgangsstufen.
3.Teilnahmevoraussetzungen und Registrierungsverfahren
1Für eine Teilnahme ist erforderlich, dass die Schule in den an der bezuschussten Eigenbeschaffung teilnehmenden Jahrgangsstufen und Klassen (1:1-Ausstattungsklassen) folgende Voraussetzungen erfüllt:
- a)
- Technische Ausstattung
- Breitbandanschluss (Richtwert: 1 MBit/s pro Schülerin und Schüler),
- flächendeckende WLAN-Ausleuchtung,
- sichere und ausreichende Auflademöglichkeiten für die mobilen Schülergeräte vorhanden oder in Planung oder alternatives Ladekonzept (z. B. Sicherstellung einer Akkulaufzeit über den gesamten Schultag),
- Möglichkeit der drahtlosen Übertragung der Bildschirminhalte der Schülergeräte auf eine Großbilddarstellung im Klassenzimmer (Screen Mirroring).
- b)
- Zustimmung des Schulaufwandsträgers (insbesondere zur Integration personenbezogener Schülergeräte in die schulische IT-Infrastruktur).
2Zudem wird empfohlen, möglichst frühzeitig den Elternbeirat sowie die Lehrerkonferenz in geeigneter Weise einzubeziehen.
3Für die Teilnahme am Ausstattungsprozess der „Digitalen Schule der Zukunft“ sind eine Registrierung beim Staatsministerium über das Schulportal sowie eine Bestätigung durch das Staatsministerium erforderlich. 4Die Bestätigung erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel.
5Den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Schulen (z. B. hinsichtlich der bestehenden IT-Infrastruktur oder des pädagogischen Konzepts) wird durch Flexibilität hinsichtlich des Beginns der Teilnahme sowie hinsichtlich der anfänglich ausgewählten Jahrgangsstufen und Klassen im Rahmen der Vorgaben dieser Bekanntmachung Rechnung getragen. 6Dies ermöglicht es den Schulen und Schulaufwandsträgern, ggf. erforderliche konzeptionelle, organisatorische und/oder technische Vorbereitungen zu treffen. 7Die unter Nr. 2.1 genannten staatlichen Schulen, die sich nicht ab dem Schuljahr 2024/2025 an der „Digitalen Schule der Zukunft“ beteiligen, können auf ein Beratungsangebot der Beratung digitale Bildung in Bayern sowie von Schulentwicklungsmoderatorinnen und -moderatoren zurückgreifen. 8Um hierfür eine Beratungsgrundlage zu gewinnen, geben diese Schulen in der unter Nr. 3 Satz 3 genannten Schulportal-Umfrage an, in welchen Bereichen Beratungsbedarf besteht.
9Bei der Registrierung geben die Schulen die für die bezuschusste Eigenbeschaffung nach Maßgabe der Nr. 6.1.2 ausgewählten Jahrgangsstufen und Klassen an.
4.Zielsetzung und Handlungsfelder der „Digitalen Schule der Zukunft“
1Die teilnehmenden Schulen widmen sich unter Berücksichtigung bestehender Strukturen systematisch fünf Handlungsfeldern der digitalen Schulentwicklung und bearbeiten diese unter Einbindung der gesamten Schulgemeinschaft vor Ort wie auch im Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen. 2Dafür steht den Schulen ein Portfolio an Unterstützungsangeboten zur Verfügung (Nr. 5). 3Schuleigene Schwerpunktsetzungen sind möglich.
- 4.1
- Unterricht weiterentwickeln
- Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses für den Unterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen an der Schule auf Basis des Qualitätstableaus „Bayern macht gute Schule“,
- Weiterentwicklung des Fachunterrichts zur vertieften Unterstützung des Erwerbs von Fachkompetenzen durch den Einsatz zeitgemäßer digitaler Werkzeuge, Materialien und Methoden,
- verstärkte Förderung von Medienkompetenz als notwendige Voraussetzung für eine gelingende Partizipation an der mediatisierten Welt,
- gezielte Umsetzung medienerzieherischer Maßnahmen der Prävention, Reflexion und Intervention zur Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu einem sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen.
- 4.2
- Digitale Expertise stärken
- Sensibilisierung der gesamten Schulgemeinschaft für eine umfassende und nachhaltige (digitale) Transformation,
- Schulleitung: Erwerb und Vertiefung von Kompetenzen der Digital Leadership und des Change-Managements,
- Lehrkräfte: Weiterentwicklung der medienbezogenen Lehrkompetenzen in den Feldern Bedienkompetenz, Fachdidaktik und Medienerziehung insbesondere mit dem Ziel des lernförderlichen Einsatzes mobiler Endgeräte im Fachunterricht.
- 4.3
- Schule digital organisieren
- Systematisierung und Forcierung digitalisierungsbezogener Schulentwicklungsprozesse: Weiterentwicklung des schuleigenen Medienkonzepts unter den Bedingungen einer höheren Geräteverfügbarkeit, Einbeziehung der gesamten Schulgemeinschaft, schulinternes Monitoring,
- effektive und zielgruppenorientierte Kommunikationsprozesse innerhalb der Schulgemeinschaft,
- Digitalisierung von Abläufen und Prozessen.
- 4.4
- Schule kooperativ gestalten
- Stärkung der Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus im Bereich der Medienpädagogik und Schulberatungsangebote zur Sensibilisierung für die Notwendigkeit von Medienerziehung sowie zur Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Medienerziehung und häuslichen Lernbegleitung,
- Intensivierung der Zusammenarbeit im Kollegium,
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Schulen.
- 4.5
- IT-Infrastruktur optimieren
- sukzessive 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten,
- Einbindung der mobilen Endgeräte in die schulische IT-Infrastruktur.
5.Begleitung und Unterstützung des Schulentwicklungsprozesses
Folgende Ressourcen und Angebote stehen den Schulen bei der Bearbeitung der unter Nr. 4 genannten Handlungsfelder zur Verfügung:
- Praxisleitfaden In fünf Schritten zur „Digitalen Schule der Zukunft“ mit vertiefenden Online-Materialien zu den einzelnen Prozessschritten,
- Informationen zum Förderantragsprozess für Schulen und Erziehungsberechtigte,
- medienpädagogische Materialien und Angebote für den Unterricht,
- Materialien und Veranstaltungen für die medienpädagogische Elternarbeit,
- zentrale Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Schulleitungen und Lehrkräfte sowie regionale, schulartspezifische Informations- und Beratungsangebote,
- schulspezifische Beratung durch die Beratung digitale Bildung in Bayern sowie durch Schulentwicklungsmoderatorinnen und -moderatoren,
- spezifische Fortbildungsangebote auf schulinterner, regionaler und zentraler Ebene für Schulleitungen, schulische Steuerungsgruppen sowie die Lehrkräfte der ausgewählten Jahrgangsstufen,
- Möglichkeit zum Austausch und Erfahrungstransfer mit anderen Schulen.
6.Einführung und Erwerb der mobilen Endgeräte
1Die „Digitale Schule der Zukunft“ verfolgt das Ziel der Weiterentwicklung des Unterrichts auf Basis einer 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten.
2Die mobilen Endgeräte sind nicht lernmittelfreie Lernmittel im Sinne des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes.
- 6.1
- Einführung
- 6.1.1
- Auswahlgrundsätze
Die teilnehmenden Schulen (Nr. 3 Satz 3) haben bei der Einführung mobiler Endgeräte, insbesondere bei der Auswahl der 1:1-Ausstattungsklassen (Nr. 3 Satz 9 sowie Nr. 6.1.2) und der möglichen Festlegung zusätzlicher technischer Mindestkriterien (Nr. 6.1.4), die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und der sachgemäßen Kontinuität zu beachten.
- 6.1.2
- Auswahl der 1:1-Ausstattungsklassen
1Die teilnehmenden Schulen (Nr. 3 Satz 3) wählen auf Basis pädagogischer Überlegungen und des schuleigenen Medienkonzepts jährlich jeweils die Klassen von bis zu zwei Jahrgangsstufen als 1:1-Ausstattungsklassen aus. 2Im Bereich der staatlichen Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie der staatlichen Schulen besonderer Art können die Schulen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8, im Bereich der staatlichen Gymnasien aus den Jahrgangsstufen 5 bis 10 wählen. 3Insbesondere bei Schulen, die bisher noch keine Erfahrungen mit der jahrgangsstufen- oder klassenweisen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten haben, empfiehlt sich ein Start mit der Jahrgangsstufe 7 und/oder einer höheren Jahrgangsstufe entsprechend Satz 2.
4Zusätzlich gelten die bereits im Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024 ausgewählten und im Schuljahr 2024/2025 in die nächste Jahrgangsstufe vorgerückten Klassen als 1:1-Ausstattungsklassen.
- 6.1.3
- Zwingende technische Mindestkriterien
Die mobilen Endgeräte müssen folgende technische Mindestkriterien erfüllen:
- a)
- Neugeräte mit mindestens 10 Zoll Bildschirmgröße oder
- b)
- Refurbished-Geräte mit mindestens 10 Zoll Bildschirmgröße von gewerblichen Händlern mit einer Garantie von mindestens einem Jahr.
- 6.1.4
- Mögliche Festlegung zusätzlicher schulspezifischer technischer Mindestkriterien
1Die Schulen können in Abstimmung mit dem Schulaufwandsträger und dem Elternbeirat für die zu beschaffenden mobilen Endgeräte zusätzliche schulspezifische technische Mindestkriterien festlegen. 2Hierbei wird die Kompatibilität mit der vorhandenen und geplanten IT-Bildungsinfrastruktur der Schule berücksichtigt. 3Die schulspezifischen technischen Mindestkriterien können sich auf folgende Aspekte beziehen:
- Gerätetyp (Notebook, Convertible oder Tablet),
- Ausstattungskomponenten (Tastatur und/oder Stift),
- Anschlüsse (z. B. für Speichermedien, Kopfhörer, Mikrofon, Webcam),
- Betriebssystem ab einer bestimmten Version und/oder Hardwarespezifikationen,
- Bildschirmgröße (größer als 10 Zoll),
- Schnittstellen (z. B. WLAN),
- Hersteller,
- Speicherplatz,
- Anbindung an ein (bestehendes) Mobile Device Management (MDM) der Schule.
4Eine Änderung der festgelegten schulspezifischen technischen Mindestkriterien erfordert zwingende, insbesondere pädagogische oder technische Gründe.
- 6.2
- Staatlich bezuschusste Eigenbeschaffung (Selbsterwerb)
1Die Beschaffung der mobilen Endgeräte erfolgt durch die volljährigen Schülerinnen und Schüler, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern durch die vertretungsberechtigten Erziehungsberechtigten, im Namen und zum Eigentum der volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten und wird gemäß Nr. 7 staatlich bezuschusst. 2Insgesamt erhält, die entsprechenden Haushaltsmittel vorausgesetzt, jede Schülerin bzw. jeder Schüler bis zu zwei Mal in ihrer bzw. seiner Schullaufbahn eine Förderung gemäß Nr. 7.
- 6.2.1
- Unterrichtung der Erziehungsberechtigten, des Elternbeirats und der Schülermitverantwortung
1Die Schulleitung unterrichtet den Elternbeirat und die Schülermitverantwortung über die Auswahl der 1:1-Ausstattungsklassen gemäß Nr. 6.1.2 sowie darüber, welche technischen Mindestkriterien gemäß Nr. 6.1.3 und Nr. 6.1.4 ein mobiles Endgerät erfüllen muss. 2Die Erziehungsberechtigten beziehungsweise volljährigen Schülerinnen und Schüler erhalten rechtzeitig eine entsprechende Mitteilung, die auf die jeweilige Jahrgangsstufe abgestimmt ist.
- 6.2.2
- Organisatorische Unterstützung der Eigenbeschaffung durch die Schulen
1Die Schulen sollen die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler beim Beschaffungsprozess unterstützen, etwa indem sie umfassend über das Unterrichtskonzept im 1:1-Ausstattungsszenario und das Beschaffungsmodell informieren sowie ggf. auf mögliche Bezugsquellen hinweisen. 2Dabei sind die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler insbesondere über den Angebotscharakter und die Freiwilligkeit zu unterrichten. 3Soweit die Schulen für die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler Angebote einholen, weisen sie die Anbieter ausdrücklich darauf hin, in fremdem Namen zu handeln. 4Die Schulen können zudem die Beschaffungsanträge der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler bündeln und den Anbietern übermitteln. 5Anbieter und Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler können vereinbaren, dass die mobilen Endgeräte zur Erfüllung an die Schulen ausgeliefert werden. 6Die Bezahlung der mobilen Endgeräte erfolgt direkt durch die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler.
- 6.2.3
- Nichtinanspruchnahme der staatlich bezuschussten Eigenbeschaffung
1Soweit Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler das Angebot einer staatlich bezuschussten Eigenbeschaffung nicht annehmen und damit eine Ausstattung der Jahrgangsstufe mit geeigneten mobilen Endgeräten nicht erreicht werden könnte, stellen die Schulen nach Möglichkeit die fehlenden Geräte aus ihrem Bestand an Schülerleihgeräten zur Verfügung. 2Eine Beschaffungspflicht entsprechender Geräte für den Schulaufwandsträger wird hierdurch nicht begründet.
- 6.3
- Verpflichtung zur Verwendung im Unterricht
Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Verwendung des mobilen Endgeräts für schulische Zwecke und die Unterstützung durch die Erziehungsberechtigten richten sich nach Art. 56 und 76 BayEUG.
7.Richtlinie zur Förderung der 1:1-Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten
Im Rahmen der „Digitalen Schule der Zukunft“ unterstützt der Freistaat Bayern die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler finanziell bei der Eigenbeschaffung mobiler Endgeräte als nicht lernmittelfreie Lernmittel mit einer Zuwendung.
- 7.1
- Zweck der Zuwendung
Die Zuwendungen werden gewährt, um die für das Lernen in einer Kultur der Digitalität erforderliche Geräteausstattung zu gewährleisten.
- 7.2
- Gegenstand der Zuwendung
1Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung eines mobilen Endgeräts einschließlich der von den Schulen verbindlich vorgegebenen Ausstattungskomponenten gemäß Nr. 7.4. 2Mobile Endgeräte im Sinne dieser Richtlinie sind Endgeräte, die aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts ohne größere körperliche Anstrengung tragbar und somit mobil zur Sprach- und Datenkommunikation einsetzbar sind (Laptops/Notebooks, Tablets oder Convertibles). 3Von der Zuwendung ausgenommen sind Mobilfunktelefone sowie Smartphones.
- 7.3
- Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger
Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger sind die volljährigen Schülerinnen und Schüler einer 1:1-Ausstattungsklasse, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern deren Erziehungsberechtigte.
- 7.4
- Zuwendungsvoraussetzungen
- 7.4.1
- Kein Ausschluss durch vorangegangene Förderungen
Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn
- a)
- bereits eine Förderung im Rahmen der „Digitalen Schule der Zukunft“ erfolgt ist und
- diese noch der Zweckbindung (Nr. 7.10) unterliegt oder
- die Beschaffung des zweiten Geräts nicht spätestens für die 9. Jahrgangsstufe bzw. am Gymnasium für die 12. Jahrgangsstufe erfolgt;
oder
- b)
- bereits zwei Mal eine Förderung im Rahmen der „Digitalen Schule der Zukunft“ erfolgt ist.
- 7.4.2
- Technische Anforderungen
Ein mobiles Endgerät ist nur förderfähig, wenn es die zwingenden technischen Mindestkriterien gemäß Nr. 6.1.3 und ggf. die zusätzlich festgelegten schulspezifischen technischen Mindestkriterien gemäß Nr. 6.1.4 erfüllt.
- 7.5
- Art und Umfang der Zuwendung
- 7.5.1
- Art der Zuwendung
1Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 350 Euro je förderfähigem Endgerät im Sinne der Nr. 7.2 gewährt. 2Liegen die Anschaffungskosten unter dem Festbetrag, ist die Zuwendung auf den Betrag der Anschaffungskosten begrenzt.
- 7.5.2
- Zuwendungsfähige Ausgaben
Gefördert werden die Ausgaben der Beschaffung eines mobilen Endgeräts pro Schülerin oder Schüler im Sinne der Nr. 7.2.
- 7.5.3
- Mehrfachförderung
1Die Zuwendung darf zusammen mit den Zuwendungen weiterer Zuwendungsgeber, soweit diese für denselben Zuwendungszweck einzusetzen sind, die Gesamtkosten nicht übersteigen. 2Eine Zuwendung nach dieser Richtlinie entfällt, soweit für die entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben anderweitige Mittel des Freistaates Bayern in Anspruch genommen werden.
- 7.6
- Bewilligungszeitraum
1Gefördert wird die Beschaffung von Endgeräten nach Nr. 7.2 im Zeitraum der Geltung dieser Richtlinie. 2Als Beschaffung gilt der Abschluss eines rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages. 3Der vorzeitige Vorhabenbeginn wird ab Bestätigung der Teilnahme der Schule gemäß Nr. 3 Satz 3 zugelassen.
- 7.7
- Antragsberechtigung und Antragstellung
1Antragsberechtigt sind die volljährigen Schülerinnen und Schüler einer 1:1-Ausstattungsklasse (Nr. 3 Satz 1), bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern deren Erziehungsberechtigte nach Nr. 7.3. 2Für die Zuwendung sind in der Regel ein Online-Antrag mit dem vom Staatsministerium festgelegten Inhalt sowie die Kauf- und Zahlungsbelege über das hierfür bereitgestellte Verfahren einzureichen. 3Ausnahmsweise können ein vom Staatsministerium zur Verfügung gestellter Antrag sowie Kauf- und Zahlungsbelege auf Papier bei der Schule eingereicht werden; die Schule überträgt in diesem Fall Antrag und Belege in das bereitgestellte Verfahren. 4Für jede Schülerin bzw. jeden Schüler ist ein gesonderter Förderantrag zu stellen.
- 7.8
- Antragsfrist
1Der Förderantrag ist bis spätestens neun Monate nach Beschaffung des Endgeräts gemäß Nr. 7.6 Satz 2 einzureichen, spätestens jedoch zwei Monate nach Verlassen der Schule, für die das Gerät beschafft wurde. 2Später eingehende Anträge können grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden.
- 7.9
- Bewilligungsstelle und Bewilligungsverfahren
1Bewilligungsstelle ist das Landesamt für Schule, das seinen Entscheidungen Teilbescheinigungen der Schule zugrunde legt.
2Die Schulleitung benennt für Datenermittlung und Datenerfassung jeweils mindestens eine an der jeweiligen Schule beschäftigte Person, wobei eine davon auch die Schulleitung selbst sein kann, die sich über ein Zertifikat des MitarbeiterService Bayern identifizieren und den Antrag unabhängig voneinander überprüfen. 3Das Staatsministerium erlässt hierzu eine Dienstanweisung.
4Im Rahmen der Antragsprüfung darf die Schule auf die im Antrag gemachten Angaben vertrauen, soweit es keine Anhaltspunkte für Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Angaben gibt.
5Originalbelege verbleiben bei den Antragstellerinnen und Antragsstellern. 6Die Bekanntgabe erfolgt an die E-Mail-Adresse des Förderempfängers.
- 7.10
- Zweckbindung
1Die Endgeräte sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten Schuljahres nach dem Schuljahr, für welches das Gerät beschafft wurde, längstens aber für die Dauer des Schulbesuchs der Schülerin bzw. des Schülers dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden (Zweckbindungsfrist). 2Eine Nutzung zu außerschulischen Zwecken darf den Zuwendungszweck nicht beeinträchtigen. 3Bei einem Wechsel der Schule und/oder in eine nicht an der 1:1-Ausstattung im Rahmen der „Digitalen Schule der Zukunft“ beteiligten Klasse gilt die Zweckbindung auch als erfüllt, soweit das Gerät zum Erwerb eines geeigneten Ersatzgerätes veräußert wird, das wegen abweichender Anforderungen nach dem Wechsel der Klasse derselben oder einer anderen Schule benötigt wird. 4Der Verlust, der Defekt oder die Zerstörung des Gerätes gelten nicht als Verstoß gegen die Zweckbindung.
- 7.11
- Auszahlung
1Die Zuwendung wird nach Abschluss der Antragsprüfung, Bewilligung der Förderung und dem Nachweis der Entrichtung des jeweiligen Kaufpreises mindestens in Höhe der beantragten Zuwendung ausbezahlt. 2Die Auszahlung erfolgt nach Bewilligung durch das Landesamt für Schule auf das von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller angegebene Konto.
- 7.12
- Verwendungsnachweisprüfung
1Der vollständig eingereichte Zuwendungsantrag (Nr. 7.7) ist zugleich Verwendungsnachweis. 2Mit der Antragsprüfung erfolgt eine abschließende Prüfung des Zuwendungsfalls. 3Eine gesonderte Verwendungsnachweisprüfung findet nicht statt.
- 7.13
- Aufbewahrung der Antragsunterlagen an den Schulen
1Anträge und weitere Unterlagen auf Papier gemäß Nr. 7.7 Satz 3 sind von den Schulen für fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren. 2Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden.
- 7.14
- Nebenbestimmungen
Die Bewilligung der Förderung ist mit folgenden Nebenbestimmungen zu versehen:
- 7.14.1
- Verwendung der Zuwendung
1Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. 2Die Endgeräte sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten Schuljahres nach dem Schuljahr, für welches das Gerät beschafft wurde, längstens aber für die Dauer des Schulbesuchs der Schülerin bzw. des Schülers, dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden (Zweckbindungsfrist). 3Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Verwendung der mobilen Endgeräte für schulische Zwecke und die Unterstützung durch die Erziehungsberechtigten richten sich nach Art. 56 und 76 BayEUG. 4Eine Nutzung der Geräte zu außerschulischen Zwecken ist zulässig, soweit sie die schulische Nutzung nicht beeinträchtigt.
- 7.14.2
- Nachweis der Verwendung
1Der Nachweis der Verwendung erfolgt durch Verwendungsbestätigung, die mit dem vollständigen Antrag erbracht ist, und die zugehörigen Belege, die bereits bei der Antragstellung eingereicht werden. 2Der Kaufbeleg ist fünf Jahre ab Antragstellung aufzubewahren, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
- 7.14.3
- Prüfung der Verwendung
1Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängerinnen und -empfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO).
- 7.14.4
- Erstattung
1Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 2Dies gilt insbesondere, wenn die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist. 3Anstelle des in VV Nr. 8.7 zu Art. 44 BayHO genannten Wertes gilt für Rückforderungen eine Bagatellgrenze von 50 Euro.
- 7.15
- Datenschutz
1Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt für die Zwecke des Vollzugs dieses Förderverfahrens einschließlich der Prüfung auf das Vorliegen früherer Zuwendungen nach dieser Richtlinie, für Zwecke der Rechnungsprüfung sowie in anonymisierter Form für Zwecke der Evaluation. 2Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) einzuhalten. 3Die Bewilligungsbehörde ist Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 4Die Verpflichtungen aus der DSGVO (insbesondere die Betroffenenrechte und die Informationspflichten gemäß Art. 13f. DSGVO) werden durch die Bewilligungsbehörde erfüllt.
8.Evaluation
1Die Qualität von Unterrichts- und Erziehungsprozessen sowie von schulischen Organisationsprozessen wird im Rahmen der externen Evaluation untersucht und bewertet. 2Ergänzend werden spezifische Prozesse im Rahmen der „Digitalen Schule der Zukunft“ vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung evaluiert.
9.Inkrafttreten; Außerkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 19. Juni 2024 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.
Dr. Andrea Niedzela-Schmutte
Ministerialdirigentin